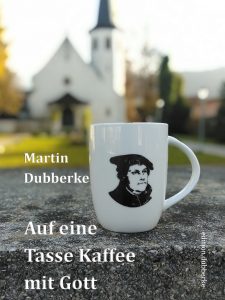Ich habe diese Woche mit jemandem telefoniert, mit dem ich seit zwei Jahren in der Regel einmal im Monat spreche. Früher hat diese Frau in Köln gearbeitet. Vor etwa einem halben Jahr ist die Firma, für die sie arbeitet, nach Berlin gegangen und so ist meine Gesprächspartnerin auch nach Berlin gezogen. Als wir in dieser Woche miteinander sprachen, fiel mir auf, dass sie ein wenig berlinerte. Also, sprach ich sie darauf an und es stellte sich heraus, dass sie in Berlin aufgewachsen und selbst schon gemerkt habe, dass sich wieder ein leichter Berliner Akzent bei ihr bemerkbar macht. Beide stellten wir fest, dass wir nur in der Heimat und mit den richtigen Menschen um uns herum, unseren Dialekt sprechen können. Eben da, wo wir uns wohl fühlen.
Und mir scheint, dass das nicht nur für’s Berlinern, sondern auch für andere Bereiche im Leben gilt. Mir stellt sich hier eine Reihe von Fragen:
- Wie kommunizieren wir eigentlich heute miteinander in Glaubensfragen?
- Welche Rolle spielt noch unser Glaube in unseren Gesprächen?
- Sprechen wir überhaupt noch eine Sprache des Glaubens?
- Oder genauer: Wo sprechen wir noch die Sprache des Glaubens?
Und wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das Gefühl, dass wir nur noch an wenigen Orten unsere Sprache des Glaubens sprechen, uns trauen, sie zu benutzen. Das ist wie mit dem Berlinern. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber mir wurde als Kind schon das Berlinern ausgetrieben, weil es nicht vornehm klingt, weil es kein Dialekt ist wie das Bayerische oder gar eine eigene Sprache wie das Plattdeutsche. Es ist ein kruder Mix aus Abgeschliffenem, Französischem und Jiddischen und was weiß ich nicht – eben Jargon. Und schon in der Schule lernten wir: Wer berlinert, dem wird nicht zugehört. Kein Lehrer hörte uns zu, wenn wir Mundart sprechen.
Und heute? Wo sprechen wir noch die Sprache unseres Glaubens? Hier in der Kirche? Hier in einem Raum wie diesem? Hier, wo wir sicher sein können, dass man uns versteht?
Also, wie kommunizieren wir heute unseren Glauben und klären Glaubensfragen?
Der Papst twittert zum Beispiel täglich. Twitter ist eine Plattform im Internet, wo man ganz kurze Nachrichten streuen kann. Sie werden es mit Sicherheit aus den Nachrichten kennen, denn viele Politiker twittern auch.
Aktuell schreibt der Papst:
Betet für mich!
— Papst Franziskus (@Pontifex_de) 13. März 2014
Klingt auf den ersten Blick ein wenig platt. Aber auf der anderen Seite ist es die Erinnerung, dass das Gebet und damit das Gespräch mit Gott ein wichtiger Teil in unserem Leben ist. Und immerhin: In Deutschland haben 178.000 Menschen die Twitter-Nachrichten des Papstes abonniert.
Oder nehmen wir unsere Berliner Generalsuperintendentin, die für rund eine viertel Million Euro 700.000 Berliner Protestanten persönlich angeschrieben hat und erzählt, wie sie beim Einkaufen am Kurfürstendamm die Glocken der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gehört hat, ihrem Ruf gefolgt ist und sich zu einer Andacht in die Kirche begeben hat. Sie hat Ihrem Brief das „Vater unser“ beigefügt. Auch ein Gebet, also die Erinnerung, dass das Gebet wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens und damit Verhältnisses zu Gott ist.
Dazu passt, dass in diesen Tage die neue Kirchenmitgliedschaftsstudie der Evangelischen Kirche in Deutschland erschienen ist, die deutlich macht, dass dem Atheismus in unserer Gesellschaft eine Rolle zukommt, die mittlerweile einen Bekenntnischarakter hat. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, bekennen dieses mit fester Überzeugung in der Öffentlichkeit.
Und wir? Was ist mit unserem Bekenntnis geworden? Wir stehen doch in einer so langen Tradition?!?! Hinter uns liegen zweitausend Jahre Christentum. Und die alttestamentliche Zeit wage ich gar nicht hinzuzurechnen. Was ist aus uns geworden?
Ich denke, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, sich den Predigttext anzuschauen:
Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Hebräer 11, 8-10
Der Text hat mir großes Kopfzerbrechen bereitet. Man möchte es gar nicht glauben. Da spielt der Glaubensgehorsam eine Rolle. Ist ja auch ganz klar, wenn ich an Gott glaube, dann muss dem auch der Gehorsam folgen, sonst ist das ja alles nichts. Und Gehorsam kommt von „hören“. Also heißt Gehorsam in diesem Falle nichts anderes, als auf das zu hören, was Gott sagt. Und da fängt schon das Problem an. Was sagt Gott? Wie spricht er zu uns? Wie spricht er mit uns?
Naja, zuerst über die Heilige Schrift. Wenn wir diese lesen, wissen wir schon, was er von uns will und erwartet und wie die Spielregeln aussehen, wenn ich an ihn glaube. Aber wie sieht es sonst aus?
Und da fängt das Dilemma an. Gottes Wille kann sich uns im Gespräch mit Gott, also dem Gebet offenbaren. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee erzählen: „Wisst Ihr, was mir gestern Abend, als ich gebetet habe, Gott gesagt hat, was ich tun soll?“
Na, wie würden wir alle gucken? Genau, wir würden so gucken, als wollten wir fragen, ob Sie noch alle Tassen auf dem Sender hätten. Also, schon in den eigenen Reihen hätten wir Schwierigkeiten mit einer solchen Aussage umzugehen. Woran liegt es? Weil wir so aufgeklärt sind? Weil wir glauben, dass seit dem Aufschreiben der Biblischen Bücher, Gott nicht mehr direkt mit uns sprechen könnte?
Wenn wir das schon von anderen glauben, dass sie eventuelle religiöse Spinner sind, wie gehen wir dann damit um, wenn Gott mit uns sprechen würde? Wie würde ich damit umgehen, wenn Gott zu mir sagen würde: „Lass dieses und tue jenes!“
Würde ich es überhaupt wahrnehmen? Wie ist es, wenn ich mit Gott im Gespräch bin? Ich gebe zu, dass ich selten die Ruhe dazu habe. Aber wenn ich mich mit ihm gewissermaßen verabredet habe, dann schütte ich ihm mein Herz aus. In der Regel schreibe ich, wenn ich mit ihm rede. Es ist eine Art Tagebuch. Und je mehr ich mich auf ihn einlasse, desto eher kommen Lösungen zustande. Werden Menschen genannt, die mir helfen können.
Ein Mensch ohne Glauben könnte jetzt sagen: „Ist doch kein Wunder. Du denkst einfach darüber nach, meditierst die Sache gewissermaßen und dann fallen Dir Lösungen ein. Was soll damit ein nichtvorhandener Gott zu tun haben?“
Ich glaube an Gott und ich glaube fest daran, wenn das nicht Teil meines Lebens wäre, wäre ich in vielen Dingen meines Lebens orientierungslos, würde mich vielleicht auf meinen Sachverstand verlassen, aber die Richtung würde mir fehlen. Es wäre aus meiner Sicht etwas Beliebiges.
Und noch etwas wird deutlich – eben genau das, was auch im Hebräerbrief steht:
Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande…
Der Glaube macht uns heute zu Fremdlingen, weil unsere Gesellschaft eine mehr und mehr atheistische geworden ist, in der die Kirche eine immer geringere Rolle spielt.
Und wissen Sie was? – Das ist nichts Neues. Und es ist auch keine neue Erkenntnis. Der Hebräerbrief entstand zu einer Zeit, als die Christen schon in der zweiten oder dritten Generation nach Christus lebten. Es gab also niemanden mehr, der Christus noch persönlich begegnet sein konnte. Und da passiert etwas ganz Normales: Es begann eine Abstumpfung im Hören auf das Wort Gottes. Der Glaubenseifer ließ nach und auch der Gottesdienstbesuch. All das beschreibt der Hebräerbrief. Wenn man ihn in heutige Sprache übertragen würde, könnte jeder denken, dass er unsere kirchliche Situation 2014 beschreibt.
Und in diese Situation hinein, die uns eigentlich so vertraut ist, schreibt der Autor seinen Brief an die Hebräer. Er will sie wieder ermuntern, sie im Glauben motivieren. Und was macht er dabei?
Genau, er greift auf die großen Vorbilder zurück, gewissermaßen die Superstars in Glaubensdingen. Und er erinnert daran, was die damals alles auf die Beine gestellt haben, obwohl sie Gott nicht gesehen, sondern nur gehört haben, sie nichts in der Hand hatten, keinen Beweis, kein Papier, keinen Vertrag oder sonst etwas. Sie haben einfach nur auf das Wort Gottes vertraut und sind losgegangen. Und dann haben sie Großes bewirkt, so wie Abraham.
Der Hebräerbrief ist ein einziger Mutmachbrief, nicht aufzugeben, nicht den Mut zu verlieren, sondern weiter zu machen, auch wenn kaum noch einer zum Gottesdienst kommt, auch wenn es immer weniger Pfarrstellen gibt und immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden und Kirchen geschlossen oder verkauft werden und uns statt anfeuernden Mutmachbriefen Arbeitshilfen, Statements und Grundsatzpapiere oder Thesenpapiere in die Hand gedrückt werden. Was soll’s? Mich persönlich fasziniert da schon die einfache Aufforderung des Papstes: „Betet für mich!“ – Drei kleine Worte, die alles sagen. Und dann ist es so, wie er auch in dieser Woche getwittert hat:
Unsere tiefste Freude kommt von Christus, wenn wir bei ihm verweilen, mit ihm gehen und seine Jünger sind.
— Papst Franziskus (@Pontifex_de) 7. März 2014
Der Brief an die Hebräer ist ein Brief an uns. Und er lädt uns ein, unseren Glauben zu leben und darüber zu reden. Der Glaube und Gott ist zu großartig, um in einer kleinen Kirche mit vier Wänden versteckt zu werden. Der gehört da raus auf den Markt, auf die Straße. Der Brief an die Hebräer macht Mut, über unseren Glauben zu sprechen, unsere Entscheidungen mit unserem Glauben zu begründen, mit meinem Leben und Handeln meinen Glauben und damit Gott sichtbar werden zu lassen.
So soll es sein! Amen.