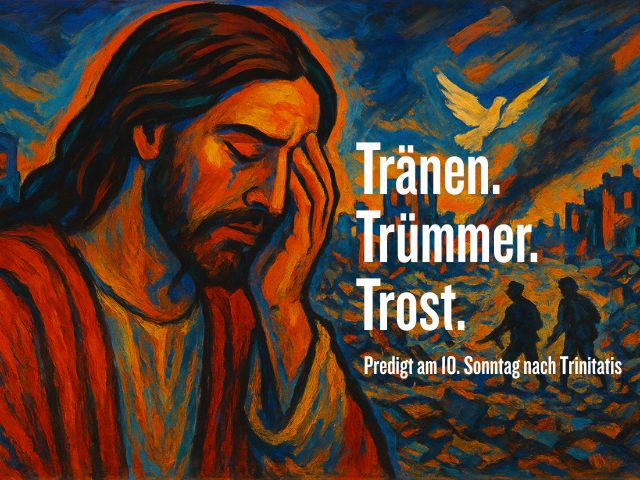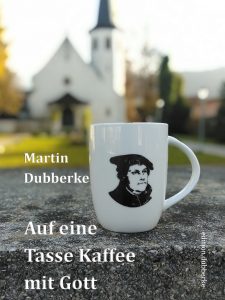Liebe Geschwister, zu Beginn des Gottesdienstes habe ich gesagt, dass die drei Stationen, die uns der Predigttext heute eröffnet, mit den Worten „Tränen. Trümmer. Trost.“ beschrieben werden können.
Tränen. Trümmer. Trost. Das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Uns ist zu Tränen zumute, wenn wir vor den Trümmern einer Beziehung stehen, den Trümmern eines Projekts, manchen Trümmern unseres Lebens, den Trümmern unserer Existenz unserer Gesellschaft und Welt. Wir denken dann darüber nach, wie das nur geschehen konnte. Was haben wir übersehen? Was haben wir geschehen lassen, das wir hätten verhindern können? Was ist unser Anteil daran?
Und dann kommt, wenn alles gut läuft, die Phase des Trostes, jemand, der uns in den Arm nimmt, der uns wieder Mut macht, der uns aufbaut und auch ins Gewissen redet.
Mit dem Predigttext ist das heute nicht viel anders, sondern nur, dass wir uns noch nicht in der Katastrophe selbst befinden, sondern gewissermaßen noch am Vorabend.
Denn als Jesus über Jerusalem weint, steht die Zerstörung der Stadt noch bevor. Erst vierzig Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, wird sich erfüllen, was Jesus vorausgesehen hat.
Was aber waren die Faktoren, die zu dieser Katastrophe führen sollten? Da waren zunächst die gesellschaftlichen Spannungen: Die römische Besatzung hatte das Land wirtschaftlich ausgeblutet. Gierige Statthalter wie Gessius Florus plünderten den Tempelschatz, Bauern verloren durch unerträgliche Steuern ihre Existenz und ihre Freiheit. Die hellenisierte Oberschicht kollaborierte mit den Römern, während das einfache Volk unter der Last der Abgaben litt. Gleichzeitig wuchs die Arbeitslosigkeit, als die jahrzehntelangen Bauarbeiten am Tempel zu Ende gingen und Tausende von Handwerkern ihre Arbeit verloren.
Hinzu kamen die religiösen Konflikte: Verschiedene jüdische Gruppen – Sadduzäer, Pharisäer, Essener und die militanten Zeloten – stritten erbittert darüber, wie Gottes Wille zu verstehen sei. Die Zeloten predigten den bewaffneten Widerstand und den alleinigen Gehorsam gegenüber Gott. Sie terrorisierten Glaubensgenossen, die zur Zusammenarbeit mit den Römern bereit waren. Messianische Erwartungen heizten die Stimmung zusätzlich an.
Schließlich eskalierte die politische Lage: Als Prokurator Florus im Jahr 66 nach Christus den Tempelschatz plünderte, brach der Aufstand aus. Das tägliche Opfer für den Kaiser wurde eingestellt – der endgültige Bruch mit Rom. Doch statt Einigkeit gegen den gemeinsamen Feind tobte in Jerusalem ein blutiger Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Rebellengruppen. Selbst während der römischen Belagerung kämpften sie gegeneinander, statt sich zu verbünden.
Und wie schaut es heute aus? Auch wenn wir wissen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, lassen sich in der Geschichte Muster erkennen, die uns auch heute noch vertraut sind. Schauen wir doch kurz unsere Gegenwart an: Auch wir leben nicht spannungsfrei.
Politisch: Der Druck auf unser Land ist groß. Der Krieg in der Ukraine zwingt uns, Position zu beziehen und unsere Sicherheitspolitik neu zu denken. Putins brutale Aggression belastet uns, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch seelisch. In Gaza scheint kein Ende der Gewalt in Sicht – täglich Bilder von zerstörten Häusern, von Kindern, die sterben. Und in den USA steht ein Mann wie Donald Trump, der eher spaltet als verbindet. All das wirkt bis zu uns.
Gesellschaftlich: Wir spüren Spaltungen auch in unserem Land. Die einen fordern mehr Härte, die anderen mehr Offenheit. Migration, Klimakrise, soziale Gerechtigkeit – das alles entzweit Nachbarschaften, Familien, politische Lager. Dazu kommt eine wachsende Polarisierung in der digitalen Welt, die selten Brücken baut, sondern Gräben vertieft. Weltweit sehen wir dieselben Muster: Nationalismen, Abschottungen, Ideologien, die nicht zusammenführen, sondern auseinanderreißen.
Spirituell: Und unsere spirituelle Seite? Religion spielt in der Gesellschaft eine immer kleinere Rolle. Die Kirchen verlieren Mitglieder und Vertrauen. Christliche Werte wie Barmherzigkeit, Vergebung, Nächstenliebe stehen zwar in Sonntagsreden, aber in der politischen Praxis geht es oft um Macht, Einfluss, Stimmenfang. Der Tempel von heute – das könnten unsere Parlamente, unsere Banken, unsere Märkte sein. Orte, an denen wir Orientierung und Wahrheit erwarten, die aber häufig von Eigeninteressen und Profitdenken geprägt sind.
Und wenn wir auf die Welt blicken, dann sehen wir auch die Trümmer: In der Ukraine liegen Städte wie Mariupol, Bachmut oder Awdijiwka in Schutt und Asche. In Gaza sind ganze Stadtviertel von Gaza-Stadt oder Chan Yunis ausgelöscht. Menschen verlieren ihr Zuhause, ihr Vertrauen, ihr Leben.
Die Zeichen der Zeit wurden nicht erkannt. Die Warnung Jesu verhallte ungehört. Und wie ist es heute? Ich glaube, wenn Jesus heute auf unsere Welt sieht, dass ihm wieder zu Tränen zumute ist.
1. Tränen – Jesu Blick auf Jerusalem
„Und als er nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie.“
Lukas 19, 41f
Diese wenigen Worte aus unserem Predigttext sagen alles.
Jesus weint. Der Sohn Gottes vergießt Tränen. Das ist bemerkenswert, liebe Geschwister. Er sieht nicht nur Mauern, sondern Herzen – Sehnsucht nach Frieden, aber Blindheit für Gottes Wege. Sein Weinen ist nicht Anklage, sondern Ausdruck seiner Liebe. Jesu Tränen sind nicht die eines machtlosen Beobachters, der hilflos zusehen muss. Jesus hätte die Macht gehabt, alles zu ändern. Er hätte Jerusalem retten können, wenn die Stadt seinen Weg des Friedens gegangen wäre. Seine Tränen sind die Tränen dessen, der liebt und dennoch nicht zurückgeliebt wird. Die Tränen dessen, der den Weg zum Frieden weist und doch nicht gehört wird. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder?
Jesus sieht Jerusalem nicht mit den Augen eines Touristen, der die prächtigen Mauern bewundert, nicht mit den Augen eines Politikers, der strategische Bedeutung kalkuliert. Er sieht die Stadt mit den Augen Gottes. Er sieht die Herzen der Menschen. Er sieht ihre Sehnsucht nach Frieden und zugleich ihre Blindheit für Gottes Wege. Er sieht, wie sie immer wieder die Gewalt wählen, wenn sie doch den Frieden haben könnten.
Sein Weinen ist keine Anklage von außen. Es ist der Schmerz der Liebe. Gott leidet mit seinem Volk. Gott leidet an seinem Volk. Gott leidet mit uns. Das ist die Botschaft dieser Tränen: Gott ist uns nicht fern, sondern so nah, dass unser Versagen ihm weh tut. Jesu Tränen zeigen: Gott sieht uns – mit Liebe und Schmerz zugleich.
Auch heute gibt es für Jesus jeden Grund zu weinen, liebe Geschwister. Grund zu weinen über die Spaltungen in unserer Gesellschaft, über den Verlust an Vertrauen in Politik und Institutionen, über die Gewalt, die wieder nach Europa zurückgekehrt ist. Grund zu weinen über eine Kirche, die oft mehr um sich selbst kreist, als ein Ort der Begegnung mit Gott zu sein. Grund zu weinen über unser eigenes Versagen, über verpasste Chancen für Versöhnung und Frieden.
Jesu Tränen sind mehr als nur Trauer. Sie sind Zeichen dafür: Gott sieht uns. Mit Liebe und Schmerz zugleich. Er gibt uns nicht preis, auch wenn wir versagen. Seine Tränen sind der Beweis seiner Liebe.
2. Trümmer – der Werteverlust im Tempel
Nach seinem Weinen über Jerusalem geht Jesus in den Tempel. Und was er dort sieht, versetzt ihn in Zorn:
„Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: ‚Mein Haus soll ein Bethaus sein‘; ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht.“
Lukas 19, 45f
Der Tempel sollte das Herz des Glaubens sein, der Ort, wo Gottes Gegenwart spürbar wird, wo Himmel und Erde sich berühren. Hier sollten Menschen Gott begegnen, hier sollten sie Vergebung finden, hier sollte Frieden herrschen. Stattdessen ist er zum Ort des Handels geworden, der Korruption, des Werteverlustes.
Das ist bitter, liebe Geschwister. Wenn sogar die heiligsten Orte ihre Bestimmung verlieren, wenn selbst im Heiligtum die Zeichen der Zeit nicht mehr erkannt werden – wo soll dann noch Hoffnung herkommen?
Die Zerstörung Jerusalems vierzig Jahre später war nicht nur militärische Niederlage. Sie war die Folge dessen, dass selbst im Zentrum des Glaubens die Orientierung verloren gegangen war.
Heute frage ich mich: Wo sind unsere „Tempel“ zu Orten des Werteverlustes geworden? Wo übersehen wir die Zeichen der Zeit, weil andere Interessen wichtiger geworden sind?
In der Politik erleben wir Gipfeltreffen und Friedensgespräche, die viel versprechen, aber wenig Perspektive eröffnen. Während in der Ukraine Menschen sterben, während im Nahen Osten der Krieg tobt, während Millionen auf der Flucht sind, dreht sich die politische Debatte oft mehr um Wahlkampf & Co. als um wirkliche Lösungen.
Und auch wir als Kirche – sind wir manchmal in Gefahr, mehr um uns selbst zu kreisen als ein offener Ort für Gottes Gegenwart zu sein? Diskutieren wir mehr über Strukturreformen als darüber, wie wir Menschen mit der Liebe Gottes erreichen können?
Die Trümmer sind nicht nur die Steine von damals. Es sind auch die zerbrochenen Strukturen und Herzen heute. Überall dort, wo Menschen die Orientierung verlieren, wo Vertrauen zerbricht, wo die Hoffnung stirbt.
3. Trost – Gottes bleibender Ruf zum Frieden
Doch Jesu Weinen bleibt nicht das letzte Wort. Die Trümmer sind nicht das Ende der Geschichte. Denn inmitten der Zerstörung, inmitten des Versagens, inmitten der zerbrochenen Träume bleibt Gottes Ruf zum Frieden bestehen.
„Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient!“
Lukas 19,42
Das ist für mich der zentrale Satz unseres Predigttextes. Das ist das große aus dem tiefsten Innern kommende seufzende „Ach!“. Ich kann geradezu hören, wie Jesus diesen Satz sagt. Das ist keine Verurteilung, sondern eine Einladung. Auch heute noch. Auch nach allem, was geschehen ist.
Der Trost liegt nicht in billiger Vertröstung. Der Trost liegt darin, dass Gott seine Menschen nicht preisgibt. Auch auf den Trümmern kann Neues wachsen. Der Tempel als Gebäude wurde zerstört, aber die Gegenwart Gottes blieb bestehen. Wo Menschen Gott Raum geben, wird sein Friede erfahrbar – auch jenseits von Mauern. Und genau das ist die Herausforderung, vor der wir in unserer Welt, in unserer Gesellschaft und auch in unserem Land stehen: Gott wieder aktiv Raum in unserem Leben zu geben, weil das alles verändern kann und auch würde. Oder anders formuliert: Der Tempel von heute entsteht dort, wo Menschen Gott Raum geben.
Für uns als Christinnen und Christen gilt heute mehr als sonst: Christus selbst ist unser Friede, wie Paulus im Epheserbrief schreibt:
Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm.
Epheser 2,14
In ihm ist Gott selbst unter uns – keine Trümmer können ihn aufhalten. Seine Liebe überwindet alle Grenzen, seine Vergebung heilt alle Wunden, sein Friede ist stärker als alle Gewalt.
Mehr denn je gilt heute der Ruf:
„Erkenne, was zum Frieden dient!“
Das ist keine naive Aufforderung zu falschem Optimismus. Das ist eine Einladung, die Zeichen der Zeit neu zu sehen. Das ist die Einladung noch einmal in die Geschichte zu schauen, weil es nichts Neues unter der Sonne gibt. Nicht umsonst sagt Jesus gleich darauf:
Aber nun ist’s vor deinen Augen verborgen.
Lukas 19,42
Das ist die Blindheit, die vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Doch das „Erkenne, was zum Frieden dient“ ist die Einladung mit den Augen Jesu zu schauen. Und Jesus bewies an dieser Stelle Weitsicht. Noch waren es vierzig Jahre bis zur Katastrophe. Doch die Menschen haben nicht auf ihn gehört. Vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, wie viele Jahre sind wir noch von der finalen Katastrophe entfernt. Wie viele Jahre bleiben uns noch, zu erkennen, was dem Frieden dient und vor allem danach zu handeln? Sollten es noch vierzig Jahre sein, ist das nicht viel. Wir alle wissen, wie schnell diese Zeit vergeht, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen. Vierzig Jahre sind in der Geschichte weniger als eine Sekunde.
Der besorgte, geradezu seufzende Satz Jesu:
Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient!
Lukas 19,42
ist die ausdrückliche Einladung Jesu, Frieden zu suchen – im persönlichen Umfeld, wo zerbrochene Beziehungen auf Heilung warten. Frieden zu suchen in unserer Gesellschaft, wo Spaltungen überwunden werden müssen. Frieden zu suchen im Blick auf die Konflikte unserer Zeit, auch im Blick auf Israel und Gaza, wo die Gewalt wieder eskaliert.
Das ist unsere Verantwortung als Christinnen und Christen: nicht wegzuschauen, nicht zu resignieren, sondern aktiv zum Frieden beizutragen. Durch unser Gebet, durch unser Handeln, durch unsere Haltung.
Wir kennen diesen wunderbaren Satz, mit dem wir immer wieder getröstet werden oder uns selbst Mut zusprechen: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Nein, die Hoffnung stirbt nie. Denn sie gründet nicht in menschlichen Möglichkeiten, sondern in Gottes Treue. Christus ist unser Friede. In ihm ist die Mauer der Feindschaft eingerissen. In ihm haben Tränen und Trümmer nicht das letzte Wort.
Schlussgedanken
Tränen – Trümmer – Trost. Das sind nicht nur drei Stationen, die Lukas uns hier mit dieser Geschichte beschreibt. Das ist der Dreiklang unseres Glaubens, der Rhythmus unserer Existenz.
Jesu Tränen zeigen uns: Gott sieht unsere Not. Er leidet mit uns. Seine Liebe ist größer als unser Versagen.
Die Trümmer mahnen uns: Wir sollen endlich die Zeichen der Zeit erkennen. Wir sollen nicht wegsehen, wo Unrecht geschieht, wo Menschen leiden, wo Frieden bedroht ist.
Der Trost aber öffnet den Blick: Auch in unseren Unsicherheiten, auch in den Katastrophen unserer Zeit bleibt der Weg zum Frieden offen. Gottes Ruf ergeht heute neu an uns.
Liebe Geschwister, lasst uns heute Gottes Ruf hören. Lasst uns die Tränen zulassen, wo sie nötig sind. Lasst uns die Trümmer nicht verdrängen, sondern sie beim Namen nennen. Und lasst uns den Trost annehmen, der von Gott kommt.
Denn wer zu Jesus Christus gehört, der gehört zu denen, die zum Frieden berufen sind. Nicht als Träumer, sondern als Realisten der Liebe. Nicht als Weltverbesserer, sondern als Menschen, die wissen: Gott gibt uns nicht preis.
Amen.
Pfr. Martin Dubberke
Predigt am 10. Sonntag nach Trinitatis Israelsonntag Gedenktag der Zerstörung Jerusalems in der Johanneskirche zu Partenkirchen am 24. August 2025, Perikopenreihe I, Lukas 19,41-48
Kontakt & Feedback
Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen oder mit mir ins Gespräch kommen möchten oder ein Feedback zu meiner Predigt geben wollen, schreiben Sie mir bitte einfach eine kurze Nachricht:
Kleiner Buchtipp am Rande
 Ihr erhaltet das Buch in der Buchhandlung Eures Vertrauens oder:
Ihr erhaltet das Buch in der Buchhandlung Eures Vertrauens oder:- als gebundene Ausgabe direkt beim Verlag
- als eBook bei der Buchhandlung meines Vertrauens
- oder als gebundene Ausgabe oder eBook bei Amazon